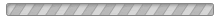Zwei Kanten sind gerade Brüche, die übrigen unregelmässig. Die Bildfläche ist etwas reduziert. Darstellung auf einer Seite in rot, schwarz und grün.
Auf einem Podium mit Treppe rechts, das schwarz gezeichnet ist, steht eine Katze, die grün gemalt ist mit schwarzen Umrisslinien und Details im Fell. Auf ihrem Rücken steht ein schwarzer Vogel, anscheinend mit zurückgewandtem Kopf, und über diesem scheint ein anderer Vogel geschwebt zu haben, dessen einer Flügel in schwarz und rot noch sichtbar ist Dieser Vogel hat möglicherweise ein Jn-Zeichen in dem einen Fang gehalten. Der Flügel, der noch festzustellen ist, scheint nicht zu dem sitzenden Vogel zu gehören. Die Katze und der Vogel auf ihrem Rücken sind nach rechts gewandt. Vor dem Podium steht ein Mann, der diesem zugewandt ist. Er ist rot gemalt mit schwarzen Umrisslinien und Detaüs. Er ist nackt und trägt ein Amulett, vermutlich ein Herz, als Anhänger um den Hals. Die Frisur besteht aus einem Haarbüschel vorn auf dem sonst kahlen Kopf und aus einem Zopf hinten. In der rechten Hand hält er einen Tierschenkel, rot mit schwarzen Konturen.
Ikonographisch gesehen muss das Bild im Zusammenhang mit einem Ostrakon aus Deir el Medineh betrachtet werden. Auf einem Bild in dem französischen Material sieht man einen fast identischen Jungen in derselben Haltung vor einer Katze stehen (VA 2723). Während man in dem Stockholmer Bild eher eine Adorations- und Opferszene sehen möchte, scheint das andere Bild einen anderen Charakter zu haben, der Junge scheint drohend aufzutreten. Dieses ist bei dem Stockholmer Bild jedoch nicht völlig ausgeschlossen, der Gestus ist nicht der eines Opfernden. Der Gestus des Jungen auf dem Bild aus Deir el Medineh knüpft an die Darstellungen der Affenhüter an, die mehrfach dem Affen in dieser Weise drohen (z.B. VA 2035 ff.). Obwohl unklar, möchten wir primär dieses Bild als religiös ansehen. Nach einer hypothetischen Interpretation könnte dieses Bild die Göttin Tefnut in Katzengestalt zeigen.
Aus der hellenistischen Zeit gibt es, teUs in Tempelinschriften”, teUs auf einem Papyrus in Leiden”, Fragmente bzw. eine ausführlichere Version des Mythos dieser Göttin, Res Tochter. Wegen Streitigkeiten mit dem Vater zog sie weg von Ägypten und lebte als Wildkatze in Nubien. Ihr Vater sandte jedoch nach ihr. Thoth sollte sie nach Hause locken. Diesem gelingt es auch u.a. durch Erzählungen in Fabelform, und Tefnut kehrt nach Ägypten zurück, wo sie im Triumf^ empfangen wird. Hinter diesem Mythos liegt die Beobachtung der jährlichen Kraftabnahme der Sonne während des Winterhalbjahres.
Tefnut ist vielgestaltig. Sie kann sich nicht nur als Katze offenbaren, sondern auch als Löwin, brüllend und bösartig. Der Mythos von Tefnut ist literarisch nur in hellenistischer Zek belegt. Jedoch hat W. Spiegelberg — und in seiner Folge E. Brunner-Traut — eine Darstellung eines Berliner Ostrakons aus den deutschen Grabungen in Deir el Medineh als Illustration zum Mythos von der katzengestaltigen Toditer der Sonne gedeutet und damit einen TeU des Mythos bedeutend früher datieren können”. Dieses BUd in Berlin könnte eine direkte Illustration des Mythos sein wie auch ein Relief römischer Zeit im Tempel von Dakke in Nubien”.
Die Darstellung auf dem Stockholmer Bild ist keine Illustration des Mythos, sondern scheint vor allem eine Opferszene zu zeigen. Gewiss gibt es andere Katzengöttinnen in Ägypten als Tefnut, aber was eine Identifikation mit ihr andeutet, ist der Vogel, der sich über ihr befindet. Sowohl auf dem Berliner Ostrakon als auch auf dem Relief in Dakke ist ein Vogel über ihr wiedergegeben. Das Berliner BUd konnte nicht eindeutig erklärt werden. Vielleicht ist es eine Illustration zu dem, was Thoth Tefnut erzählt, vielleicht ist es ein Teil des Mythos, der uns unbekannt ist, oder hat es vielleicht damit zu tmu dass Tefnut sich als Geier offenbaren konnte”? Das Bild von Dakke zeigt über Tefnut einen Geier, aber dieser dürfte nur die traditionelle Schutzgöttin Nedibet sein. Auf dem Stockh<Umer BUd wäre es nicht ausgeschlossen, den Vogel als Falken zu ktentifboeren, der den Kopf zurückwendet und zu dem schwebenden Vogel aufsieht, der Nechbet sein könnte. Der Falke könnte Tefnuts männlicher Partner Onuris sein, der nach einer Variante des Mythos sie aus Nubien zurückholte”. Onuris tritt meist in Menschengestalt auf, manchmal mit Falkenkopf, aber es dürfte nicht unmöglidi sein, ihn als Falken abzubUden, nicfat zuletzt deshalb, weU die Verbindungen zwisdieo ihm und dem wichtigsten Falkengott, Horns, sehr eng sind.
Dieses BUd, das also hypothetisch Tefnut und Onuris wiedergeben könnte, ist einzigartig und ungewöhnlich insoweit, als die DarsteUung der beiden Götter über einander sonst nicht in der konventioneUen ägyptischen Kunst voiicommt, aber auch in seinem Charakter als „AugenblicksbUd“, wie der Falke den Kopf zurückwendet und nach oben sieht
Die Szene, die dieses BUd zeigt, ist das Darbringeo von einem Opfer an Tefnut Der mUde und freundliche Aspekt der Katze tritt hervor, Tefout ist nicht die wUde Löwin”. Was sidi abspielt, ist gewissermassen das Besänftigen des Raubtieres”. Ob die droheode Haltung der Männer vor den Katzen auf den beiden Ostraka einen psychologischen Hintergrund haben könnte? Zur Abwehr fertig, wenn die Besänftigung nicht gelingen soUte?
Der Opferer ist wahrscheinlidi ein Nubier, da er mit t^weise rasiertem Kopf und Amulettanhänger auftritt. Auch darin, dass ein Nubier der Tefnut opfert, kann man eine Bestätigung der obigen Deutung des Bildes sehen, eine Andeutung von Tefnuts südlichem Aufenüialtsort.
In Theben, wo die hier erwähnten Ostraka gefunden sind, gibt es keine speziellen Tefnut-Kulte”. Im Mythos konunt Tefnut aber auch dorthin und wird mit Lobgesängen als Göttin Mut begrüsst In einem Hymnus des Papyrus Leiden I 350 wird von ihr erzählt, dass sie sich in Theben in Gestalt der Löwengöttin Sechmet niederliess*^. Dort bestand also die Möglichkeit, in anderen Göttiimen Tefnut zu verehren.
Das BUd könnte freilich als eine Votivgabe interpretiert werden. Widitig ist, die erwähnte ikonographische Parallele festzuhalten; das Thema icht einzigartig, sondern hat wahrscheinlich eine este Tradition. (Peterson 1973:81-82)




 ARTIKLAR I WIKIPEDIA
ARTIKLAR I WIKIPEDIA ARTIKLAR I WIKIDATA
ARTIKLAR I WIKIDATA BILDER I WIKIMEDIA COMMONS
BILDER I WIKIMEDIA COMMONS